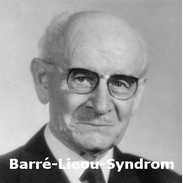Stell Dir vor, Du stirbst und niemanden interessierts
Meine Geschichte beginnt an einem Donnerstag im Dezember 2017.
PATIENTIN A.M.
„Nichts. Es gibt nichts, was man tun könnte. Ich bin da ganz ehrlich mit Ihnen, weil Sie das wissen müssen. Diese Erkrankung ist wirklich selten."
Die menschliche Würde und das Recht auf medizinische Hilfe scheinen dort zu enden, wo ein Arzt meint, dass ein Fall zu kompliziert oder aufwändig ist, als dass er sich jetzt damit beschäftigt.
Dezember 2017:
Ich war gerade 17 Jahre alt geworden und in der 11. Klasse.Eigentlich verlief zu der Zeit alles normal, nur gab es Streitigkeit zwischen meiner Freundin und ihrem damaligen Freund, der sich innerhalb kurzer Zeit charakterlich sehr stark verändert hatte. Er stalkte sie regelrecht, schrieb ihr vor, wo sie zu sein und was sie zu tun hatte, und rief sie hunderte Male am Tag an, um zu überprüfen, mit wem sie redete. Irgendwann wurde er gewalttätig, wenn sie nicht das tat, was er von ihr verlangte. Es eskalierte jeden Tag ein wenig mehr und selbst die Lehrer bekamen es mit, aber niemand tat etwas. An diesem Schuldonnerstag hatten wir uns gerade in den nächsten Klassenraum gesetzt und warteten, dass der Unterricht beginnen sollte, als beide den Raum betraten. Meine Freundin kam zu uns und sagte etwas in die Richtung „Ich möchte bei meinen Freunden sitzen“. Schneller als wir es damals realisieren konnte, schlug er mit den Worten „Du bleibst bei mir“ zu und wir alle starrten ihn entgeistert an. Mehr aus Reflex sprang ich damals auf und schubste ihn mit einem „Geht‘s noch? Was läuft falsch bei dir?“ von ihr weg, unwissend, welche Konsequenzen das für mich haben würde.
Keine zwei Stunden später im Sportunterricht, als ich mich gerade mit meiner Freundin unterhielt, kam der Schlag. Und das so unerwartet und so heftig, dass ich erst realisierte, was passiert war, als ich auf dem Boden lag. Nach den Schilderungen der anderen war er durch die gesamte Sporthalle auf mich zugelaufen und hatte mich dann mit der Faust von links seitlich im Übergang HWS-Kopf getroffen. Ich spürte sofort, dass irgendwas verletzt worden war. Alles fühlte sich komisch an. Wie ich die Umwelt wahrnahm, wie ich meinen Körper fühlte, wie mein Herz schlug. Irgendwas war passiert. Zu meinem Lehrer sagte ich noch: „Ich glaube, mein Gehirn ist verletzt worden“. Und damit sollte ich Recht behalten, ich wusste es nur damals nicht.
Keine 5h später saß ich im Krankenhaus, weil immer mehr neurologische Symptome auftraten. Anfallsartig wurden Geräusche immer wieder so intensiv laut, dass selbst das Umblättern einer Buchseite unerträglich für mich wurde. Hinzu kamen visuelle Probleme, Übelkeit, Kopfschmerzen und ein immer stärker werdender Druck in meinem Kopf. Außerdem lief meine linke Gesichtshälfte unter dem Auge immer wieder blau an. Der behandelnde Arzt in der Uniklinik untersuchte mich nicht. Er meinte nur zu mir: „Du bist so jung, was soll da schon kaputt gegangen sein. Weißt du, wir haben hier Leute, die bekommen einen Schlag und wissen danach nicht, wer sie überhaupt sind. Wenn es dir so geht, kannst du gerne wiederkommen.“
Das war nicht wirklich nett, aber es beruhigte mich erstmal dahingehend, dass das, was ich hatte, wohl nicht so schlimm sei.
Über Nacht jedoch steigerten sich die Symptome so sehr, dass ich am nächsten Tag in der Kinderklinik des städtischen Krankenhauses aufgenommen wurde wegen des Verdachts auf eine Hirnblutung. Diese konnte zum Glück ausgeschlossen werden, aber mit der Diagnose Schädel-Hirn-Trauma blieb ich erstmal für 48h unter Beobachtung. Auch weil die EKGs, an denen ich angeschlossen war, in der Nacht immer wieder Alarm auslösten, weil mein Herz angeblich nicht richtig schlug. Erklären konnte es sich keiner, aber dem Ganzen wurde dann auch nicht mehr Beachtung geschenkt, weil ein Fehler der Geräte vermutet wurde. Irgendwann gegen Anfang Januar hatten sich alle Symptome beruhigt.
Februar 2019:
Im Februar 2019 stand ich kurz vor den Abiturprüfungen. Es war die Zeit, wo nicht mehr allzu viel in der Schule stattfand und wir nur noch zusammen lernten. So ziemlich von einem Tag auf den anderen traten Schmerzen in meinem linken Thorax und meinem linken Arm auf. Es war nicht die Art von Schmerzen, bei denen ich mir Sorgen machte, dass es etwas Schlimmes sein könnte. Es waren einfach Schmerzen, von denen ich erwartete, dass sie mit dem langen Sitzen zusammenhingen. Aber da hinzukam, dass ich den Eindruck hatte, mein Herz würde nicht richtig schlagen, ließ ich mich sicherheitshalber bei meinem Hausarzt untersuchen. Ergebnis: Alles normal.
Nur einen Tag später im Informatikunterricht in der Schule wurden die Schmerzen schlimmer. Wir saßen gerade in Gruppen vor den Laptops und zeichneten gegenseitig Bilder mit einem Paint-Programm, weil wir nicht wirklich etwas zu tun hatten. Ich ignorierte die Schmerzen so gut wie möglich, bis ich etwas wie ein Stromschlag in meiner Herzgegend spürte. Ich drehte mich zu meinen Freunden und sagte: „Ich hatte gerade so etwas wie einen Stromschlag in meinem Herzen. Das hat sich nicht normal angefühlt.“ „Bitte, stirb jetzt nicht, ist gerade ein ungünstiger Zeitpunkt“, lachte meine eine Freundin und ich lachte mit. Aber schlagartig veränderte sich der Schmerz in meiner Brust. Es war kein Schmerz mehr, aber auch kein Gefühl, was ich jemals zuvor in meinem Leben gespürt hatte. Wenn ich es beschreiben sollte, würde ich sagen, es war wie ein Kribbeln und Krampfen zugleich, aber unter der Haut. Und auch das würde das Gefühl nicht zu 100% wiedergeben können. Auf jeden Fall war es so unerträglich und schrecklich, dass ich das Bedürfnis hatte, es musste sofort aufhören. Jetzt sofort. Aber das tat es nicht. Ich ließ mich auf den Tisch vor mir sinken und drückte mit den Händen gegen meine Brust, in der Hoffnung, dieses Gefühl unterbrechen zu können. Aus der Ferne konnte ich hören, wie jemand davon redete, einen Krankenwagen zu rufen. Aber ich konnte nicht antworten. Ich konnte nichts sagen, ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte nur liegen und es aushalten. Nur wenige Sekunden später spürte ich, wie mein Herz aus dem Takt kam und kurz darauf ganz stoppte. Eine Sekunde, zwei Sekunden, drei…ich fühlte, wie mein Kreislauf zusammenbrach und ich kurz davor war, komplett das Bewusstsein zu verlieren. Dann fing es wieder an zu schlagen. Aber nun komplett entgegengesetzt. Es schlug immer schneller und mit jedem weiteren Schlag steigerte es sich weiter, bis es nur ein unzureichendes Krampfen oder Zucken war, das sich nicht mehr wie ein Teil meines Körpers anfühlte. Jeder Schlag war wie ein Faustschlag von außen in meinen Thorax, der es mir unmöglich machte zu atmen. Ich hörte, wie ich noch schrie, aber auch das konnte ich nicht mehr kontrollieren und während mein Körper ohnmächtig wurde, fühlte es sich an, als würde ich aus ihm herausgezogen werden. Was folgte, war etwas, was andere als Nahtoderfahrung bezeichnen würden. Wahrscheinlich das Ergebnis von akuter Sauerstoffunterversorgung und Schockreaktion meines Körpers. Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, wie ich dabei sehr klar und nüchtern dachte: „Oh,…ich sterbe gerade. Ich will nicht sterben“.
Als ich wieder aufwachte, lag ich auf dem Boden in unserem Informatikraum, meine Freunde um mich herum. Ich zittere unkontrolliert und etwas, was sich anfühlt wie Blitzschläge oder extrem schmerzhafte Nadelstiche zogen von der Mitte meines Thorax zu meiner linken Thoraxseite. Anscheinend sah ich so dezent nach Leiche aus, dass mein Lehrer den Raum verließ, um zu weinen, während die Rettungssanitäter auf dem Weg waren. Ich streckte meine Hand nach der Hand meiner besten Freundin aus, in dem verzweifelten Versuch, dass mich das irgendwie bei ihr halten könnte. Ansonsten traute ich mich nicht, mich zu bewegen, weil ich das Gefühl hatte, kurz vor dem nächsten Anfall zu stehen. Es war, als wenn ich diesen durch eine kleinste Bewegung auslösen könnte.
Als die Sanitäter kamen, wurde sofort ein EKG gemacht und ich mit der Aussage „Verdacht auf Myokardinfarkt“ direkt in die nächste Klinik gebracht. Es war das erste Mal, dass ich so wirklich gespürt habe, was es bedeutet, Todesangst zu haben. Mir war klar, einen zweiten solchen Anfall würde ich nicht schaffen. Ich stand so unter Schock, dass ich nicht einmal weinen konnte, ich lag nur da und atmete möglichst flach, um mich ja nicht zu bewegen. In der Klinik standen dutzende Ärzte um mich herum. Mein Herz schlug immer noch stark arrhythmisch, was ich am Monitor neben mir mitverfolgen konnte, und eine Ärztin murmelte etwas von: „Frau M., Sie brauchen keine Angst zu haben, wir haben alles hier vor Ort und können Sie direkt wiederbeleben, wenn etwas passiert“. Das war bestimmt nett gemeint, aber eher wenig beruhigend in der Situation. Den ganzen Tag über wurde mein Herz untersucht, aber nichts gefunden. Röntgen: unauffällig. Ultraschall: unauffällig. Blutwerte: Die Lactatdehydrogenase war um das 7-fache erhöht, aber keine anderen Herzenzyme. Also kein Herzinfarkt.
Dann gegen 20 Uhr ein Schichtwechsel. Ein neuer junger Assistenzarzt kam zu mir, schaute sich meine Akte an, dann mich. „So Frau M., wieso sind Sie eigentlich hier? Alle Werte sind super, sie haben nichts, es gibt keinen Hinweis darauf, dass dieser Anfall überhaupt stattgefunden hat“. Ich starrte ihn nur entsetzt an und versuchte zu verarbeiten, was er gerade gesagt hatte. „Aber die EKGs haben doch…“, doch er unterbrach mich direkt und recht unfreundlich. „Wissen Sie, Sie können wirklich ganz ehrlich mit mir sein. Ich habe gerade in ihrem Bericht gelesen, dass Sie Abiturientin sind. Ist alles ein bisschen zu viel für Sie, oder?“ Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Ich hatte mit allem gerechnet, aber nicht mit dieser Aussage. Obwohl ich ihn anflehte, mich dort zu behalten, weil ich spüren konnte, dass der nächste Anfall kurz bevorstand, entließ er mich mit der Aussage, ich sei viel zu jung, um krank zu sein, und wenn es schlimm wäre, wäre ich direkt beim ersten Anfall gestorben. Ich durfte gehen, sobald ich wieder stehen konnte. Und das war gegen 2 Uhr morgens. Meine Mutter und ich wurden von einem Taxi abgeholt, dessen Fahrer mich etwas entgeistert anschaute und uns mit einem kritischen „Sie sehen aus wie eine Leiche. Sind Sie sicher, dass es eine gute Idee ist, Sie von der Klinik wegzubringen?“ begrüßte.
Zuhause angekommen setzte ich mich erstmal und versuchte zu verkraften, was da soeben geschehen war. Ich war mir sicher, dass den Ärzten beim Schichtwechsel ein Fehler unterlaufen sein musste, ich wusste doch, was mir passiert war. Und alle anderen, die dabei waren, wussten es auch. Ich fragte meine Mutter, ob sie mich in ein anderes Krankenhaus bringen könnte, aber sie lehnte ab, weil die Ärzte schon Recht haben würden. Also fragte ich, ob ich wenigstens bei ihr im Bett schlafen dürfte. Für den Fall, dass ich im Schlaf sterben würde, wollte ich nicht alleine sein. Dann nahm ich mein Handy und schrieb Nachrichten an meine Freunde. Dass ich für alles dankbar war, was sie für mich getan hatten, dass ich sie unglaublich liebhatte und dass ich mal schauen würde, was die Nacht so bringen würde. Zu diesem Zeitpunkt rechnete ich damit, dass es die letzten Nachrichten waren, die ich in meinem Leben verfassen würde.
Am nächsten Tag wachte ich gegen 8 Uhr morgens auf und versuchte erstmal zu verarbeiten, dass ich noch lebte und was am vorherigen Tag passiert war. Meine Oma fuhr mit mir zu unserem Hausarzt. Sie begrüßte ihn mit den Worten „Meine Enkelin hat Stress mit dem Abitur und deswegen ist sie krank“, dann übergab sie ihm den Arztbrief aus der Klinik. Ich versuchte etwas zu sagen, aber der Arzt ließ mich nicht aussprechen. Er belächelte mich wie ein dummes Kind, dann sagte er, dass er sowas ganz häufig sehen würde, gerade bei Frauen in meinem Alter. Ich konnte es nicht fassen. Wie sollte etwas so unerträglich Schreckliches normal sein? Ein Langzeit-EKG lehnte der Arzt ab und er erklärte mir, dass er da wichtigere Patienten haben würde. Dann drückte er mir 10 Tabletten Tavor und ein Rezept für ein Antidepressivum in die Hand, weil es mir „helfen würde, besser für mein Abitur zu lernen“.
Mitte April 2019:
Zu diesem Zeitpunkt konnte ich zwischen Symptomen und Anfällen unterscheiden. Krankheitssymptome traten fast dauerhaft auf, einen richtigen Anfall hatte ich aber nur alle 2-3 Tage. Zum Glück war keiner so schlimm wie der initiale erste Anfall, auch wenn alle in ihrer eigenen Art und Weise grausam und unerträglich waren. Ich hatte gelernt, dass ich einen Anfall direkt über Koffein/Teein oder Kopfbewegungen auslösen konnte. Zu den Herzrhythmusstörungen waren Lähmungserscheinungen, unwillkürliche Zuckungen am ganzen Körper, Sensibilitätsstörungen, Temperaturempfindungsstörungen, visuelle Probleme und Hörstörungen hinzugekommen. Außerdem trat zwei Wochen nach Beginn der Erkrankung eines der schlimmsten Symptome auf, nämlich das Gefühl, dauerhaft kurz vor dem Ersticken zu stehen. Nachts wachte ich davon auf, dass ich vergaß zu atmen, tagsüber hatte ich das Gefühl, mich jede Sekunde darauf konzentrieren zu müssen, überhaupt zu atmen. Immer wieder wurde ich ohnmächtig.
Die Schultage verbrachte ich auf dem Boden des Klassenzimmers liegend. Hingehen sollte ich von meinen Eltern trotzdem, weil die Ärzte schon Recht haben würden. Ich müsste mich da doch nur einfach mal überwinden und mich nicht so anstellen, dann würde das mit meinen „psychischen Problemen“ schon wieder in Ordnung kommen. Mein Opa erzählte mir, dass sein Kardiologe meinte, ich solle einfach mal mehr Sport machen. Die Tatsache, dass ich mein Leben lang geturnt hatte, Rettungs- und Wettkampfschwimmerin war und weitere Sportvereine besuchte, wurde außer Acht gelassen. Ich wusste nicht ganz, was die Leute von mir erwarteten? Dass ich so tun würde als wäre all das nicht passiert, ne Runde Joggen gehe und dann merken würde, dass ich auf wundersame Weise geheilt war?
Ende April 2019:
Ich bin bei einem Orthopäden, der sich meine Krankheitsgeschichte anhört. Er versucht mich an der oberen Halswirbelsäule einzurenken, dann fühlt er meinen Puls und lässt ein EKG schreiben. „Frau M., Sie müssen ins Krankenhaus. Jetzt sofort. Das, was Sie da haben ist gefährlich, ich kann es nicht verantworten, Sie hier weiter zu behandeln“. Ich erzähle ihm, was beim letzten Krankenhausbesuch passiert ist und er meint, dass es egal sei, dann soll ich halt auch unfreundlich zu denen sein und mich durchsetzen, es gehe hier schließlich um mein Leben. Aber ich gehe nicht, weil meine Eltern beschäftigt sind und nicht fahren wollen.
Mai 2019:
Es ist nicht mehr viel übrig von der Person, die ich mal war. Ich kann keinen Sport machen, weil mein Herz das nicht mehr mitmacht. Ich kann nicht mehr Geige spielen, weil bei Kopfrotation ein Anfall ausgelöst wird. Auch kann ich keine schweren Dinge mehr heben, weil das starke Symptome auslöst, und zugleich fühle ich eine so große Schwäche in meinem Körper, dass ich nur noch in meinem Bett liegen möchte. Zu diesem Zeitpunkt werde ich sogar nachts im Schlaf durch Anfälle geweckt und jeder so grausam, dass ich wünschte, es würde mich endlich umbringen. Das Schlimmste ist, dass es nichts ist, wovor ich einfach weglaufen könnte. Ich bin in meinem Körper gefangen und das, was ich erlebe geht über alles hinaus, was ich ansatzweise mit Worten beschreiben könnte, geschweige denn, was ein Mensch ansatzweise verkraften könnte. Die meiste Zeit des Tages verbringe ich im Bett und versuche, einfach am Leben zu bleiben.
Zu diesem Zeitpunkt denke ich manchmal, dass ich vielleicht bereits beim ersten Anfall im Februar gestorben bin und der Rest eine Halluzination meiner Psyche ist, weil ich meinen eigenen Tod nicht verkraftet habe. Anders kann ich mir all das, was passiert, nicht wirklich erklären.
Oktober 2019:
Ich habe mein Abitur hinter mir, aber mein Zustand verschlechtert sich täglich. Zu diesem Zeitpunkt bin ich erstaunt, was der menschliche Körper doch alles ertragen und überleben kann. Insgesamt habe ich mehr als 25 Arztbesuche hinter mir und 2 weitere Krankenhausaufenthalte. Dort wurde aber nur meine Krankenakte gelesen und die psychische Ursache von „Abitur“ in „generell psychische Probleme“ umgewandelt. Für den Fall, dass ich aber doch krank sein sollte, wurde mir eine stationäre Untersuchung für Ende November versprochen.
Da meine Eltern weiterhin den Ärzten glauben, soll ich mit meinem Studium beginnen. Also sitze ich ab Mitte Oktober in den Vorlesungen für Humanmedizin. Früher wollte ich unbedingt Ärztin werden, um anderen Menschen helfen zu können, jetzt will ich nur mir selbst irgendwie helfen. Ich schaffe es kaum, in den Vorlesungen zu sitzen. Treppen kann ich kaum noch steigen, ohne ohnmächtig zu werden. Für den Fall, dass ich einen Anfall habe, sitze ich ganz außen, damit ich noch rechtzeitig den Raum verlassen kann. In der zweiten Woche des Studiums während einer Anatomie-Vorlesung spüre ich, dass es mir abrupt so schlecht geht, dass in den nächsten Minuten etwas Schlimmeres passieren wird. Ich verlasse den Hörsaal und breche direkt vor der Eingangstür zusammen. Nur Bruchteile von dem, was um mich herum passiert, bekomme ich mit. Alles dazwischen fehlt. Ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Irgendjemand redet auf mich ein, aber ich kann nicht verstehen, was er zu mir sagt, obwohl ich hören kann, dass er mit mir redet. Auch selbst kann ich keinen normalen Satz formulieren. Meine linke Körperhälfte ist wie gelähmt und ich bete einfach nur, dass das alles endlich aufhört. Als sich die Symptome ein wenig legen, bemerke ich, dass ironischer Weise genau vor mir an der Wand ein Plakat hängt, auf dem steht „Stell dir vor, du bist krank und niemanden interessierts“. Und hätte ich nicht so unglaublich schlimme Angst gehabt, ich hätte die Ironie sicher zu schätzen gewusst. „Stell dir vor, du stirbst und niemanden interessierts“, denke ich noch. Als nächstes steht mein Professor über mir, dann wird das ganze Gebäude über einen anderen Ausgang geräumt, damit ich von den eintreffenden Sanitätern versorgt werden kann. Vielleicht habe ich nur zwei Wochen Humanmedizin studiert, aber ich kann definitiv behaupten, dass ich einen Eindruck hinterlassen habe.
Bereits im Krankenhaus haben sich alle Symptome zurückgebildet und nach dem Lesen meiner Krankenakte werde ich ohne jegliche Untersuchung entlassen. Allerdings steht jetzt in meinem Bericht, dass die psychischen Probleme dadurch bedingt sind, dass ich Medizin studiere. Wer auch immer da meine Arztbriefe schreibt, scheint nicht allzu kreativ.
Zwei Tage später:
Ich kann dauerhaft meine linke Körperhälfte nicht richtig fühlen. Irgendwie bleiben nach jedem Anfall gewisse Defizite zurück, als wenn immer mehr Nervenbahnen zerstört werden würden. Während ich abends mit meiner Familie beim Essen sitze, merke ich, dass der Raum unglaublich kalt wird. Ich lege mich noch auf den Boden, dann spüre ich, wie mein Herz immer und immer langsamer schlägt. Ich kann mich nicht mehr bewegen, weil ich keine Kraft dazu habe, und es fühlt sich an, als wäre keine Luft mehr zum Atmen übrig. „Krankenwagen“, flüstere ich, „bitte“, während meine Eltern darüber diskutieren, ob ich nicht einfach eine Runde spazieren gehen sollte. Für mich fühlt es sich aber so an, als würde ich jeden Moment sterben. Als die Rettungssanitäter hinzukommen, messen sie meine Vitalwerte, die anscheinend nicht mehr so vital sind und ich lande direkt mit Blaulicht wieder in der Notaufnahme, wo ich leider keine Unbekannte bin. Auch jetzt werde ich nicht ein einziges Mal untersucht. Zwischendurch setzt sich eine Assistenzärztin zu mir und meint, ich solle mich nicht so anstellen und sie würde jetzt schonmal Leichenschau machen. Dann geht sie. Ich verstehe es nicht. Um mich herum sehe ich schwer kranke Menschen und allen wird geholfen. Auch ich bin schwer krank, nur mein Kranksein ist anders. Aus irgendeinem Grund verdiene ich es nicht, behandelt zu werden, und ich weiß nicht, wieso
Zwei Tage später:
Mit dem nächsten Anfall lande ich wieder im Krankenhaus. Aber diesmal nehmen sie mich tatsächlich direkt für 1,5 Wochen auf, um mich zu untersuchen. Als ich erzähle, dass meine Symptome durch Kopfbewegungen ausgelöst werden, antwortet die Chefärztin nur mit „Das kann nicht sein, das ist unmöglich“. Trotzdem versuche ich ihr zu erklären, dass ich glaube, dass irgendwas mit meinen Kopfgelenken ist. Ich lebe mit dieser Krankheit seit 9 Monaten, ich werde doch wissen, wo es ungefähr herkommt. Aber niemanden interessierts. Zwischendurch wird die Diagnose „Multiple Sklerose“ aufgrund von MRT-Auffälligkeiten im Gehirn gestellt, aber dann wieder verworfen. Die Tatsache, dass die Ergebnisse der Untersuchung mit evozierten Potenzialen zeigen, dass meine Nervenleitung links im Vergleich zu rechts reduziert ist, wird als Zufallsbefund abgetan.
Während ich so im Krankenhaus liege und an die Decke starre, frage ich mich, was ich getan habe, um all das zu verdienen. Wahrscheinlich nichts, aber wieso hört es dann nicht auf? Was will ich von einem Leben, was keines mehr ist? Wie soll ich etwas ertragen, was nicht zu ertragen ist? Und vor allem: Was bleibt von mir, wenn ich nicht bleibe?
Am letzten Tag, bevor ich entlassen werde, habe ich dann im Krankenhaus einen leichten Anfall. Nicht zu vergleichen, mit dem initialen Anfall aus dem Februar, aber wenigstens etwas, was die EKGs aufzeichnen können. Kurz bevor der Anfall kommt, sage ich zu der Krankenschwester, die sich im Raum befindet, dass es mir irgendwie nicht gut geht, dann verzerrt sich alles um mich herum und mein Kreislauf bricht zusammen, weil mein Herz zu arrhythmisch schlägt. Panik bricht aus und diverse Krankenschwestern kommen hinzu. Eine von Ihnen fühlt meinen Puls, dann höre ich sie sagen „Ihr Herz schlägt total unrhythmisch, wir brauchen einen Arzt“. Aber es kommt keiner. Natürlich kommt keiner. Dafür aber eine Krankenhauspsychologin, die eh mal vorbeischauen wollte, weil sie von mir gehört hatte. Ich soll mich doch mal bei einem guten Psychiater melden, den sie kennt (Anmerkung: Das war der Zeitpunkt, wo ich dann doch unfreundlich wurde).
Als die Auswertung der Untersuchungsbefunde da ist, teilt mir die Chefärztin mit, dass ich wohl POTS (=Posturales orthostatisches Tachykardiesyndrom) habe und dass das nicht so schlimm sei. Sie würde mir jetzt keine Medikamente verschreiben, aber vielleicht verwächst sich das Ganze in ein paar Jährchen. Alles andere konnte nicht zuverlässig nachgewiesen werden und sei deshalb psychisch. Sie verabschiedet sich mit den Worten, dass ich doch weiter studieren solle und dass alles gut wird. „Ja, weil es dir nicht passiert“, denke ich.
Eine Woche später:
Ich habe meinen Hausarzt gewechselt und der neue hat mich direkt zu einem Kardiologen überwiesen, der ein Langzeit-EKG schreiben lässt. Beim Verabschieden lächelt er mir zu und sagt: „Wir sehen uns in 2 Tagen wieder und dann wissen wir, was mit Ihnen ist. Sie sind nicht verrückt und dieses POTS ist es auch nicht und wir werden das jetzt beweisen“. Ich bedanke mich und gleichzeitig spüre ich, wie ich unwillkürlich anfange, zu weinen, weil ich so dankbar dafür bin, dass er mir glaubt.
Zwei Tage später:
Der Kardiologe sitzt vor mir und schaut grübelnd auf seinen Bildschirm, wo er die Auswertung des EKGs sieht, „Mhm“. Er schaut zu mir, „Mhm“. Dann druckt er hektisch Bögen aus, faltet sie und legt sie in einen Umschlag. Danach verlässt er den Raum, um zu telefonieren. Als er wieder kommt, sieht er mich ernst an „Sie müssen mir jetzt genau zuhören“. Ich blicke ihn fragend an, aber generell habe ich nicht das Gefühl, dass mich noch irgendwas umhauen könnte. „Ich tue das wirklich selten. Sie werden eine Not-Überweisung für morgen bei einem Spezialisten in einer Klink in der nächsten Stadt bekommen. Und sie müssen damit rechnen, dass es nicht leicht wird, was da morgen passiert. Es könnte eventuell ein etwas größerer Eingriff sein, also nehmen sie bitte eine Person mit, die Sie da ein wenig emotional unterstützen kann. Und versprechen Sie mir, diesen Brief nicht vorher zu öffnen. Nehmen Sie das bitte ernst. Was Sie da haben, kann gefährlich für sie werden“. „Ich weiß“, sage ich.
Der nächste Tag:
Ich sitze in der Klinik vor dem Arzt, der mir als Koryphäe auf dem Gebiet der Kardiologie beschrieben wurde. Er schaut sich meine Befunde an, mit denen ich überwiesen wurde, dann schüttelt er den Kopf. Fragend sehe ich ihn an. „Wissen Sie, Frau M., ihre Probleme kommen nicht vom Herzen, sondern vom Taktgeber im Gehirn, der scheint falsche Signale zu senden. Ich glaube Ihnen, dass es schlimm ist, aber da kann ich Ihnen so gar nicht helfen. Sie sollten einen Neurologen oder Neurochirurgen aufsuchen.“ Als ich das Untersuchungszimmer verlasse, blickt mich meine Mutter kritisch an. „Taktgeber im Gehirn“, sagt sie, „also doch die Psyche“. Damals wusste ich nicht, was das bedeutete, weil ich mich anatomisch nicht auskannte. Ich konnte mir auch nicht erklären, was mein Gehirn damit zu tun haben sollte, wenn ich doch das Gefühl hatte, die Probleme kamen von der Halswirbelsäule. Außerdem war im Schädel-MRT nichts Auffälliges gefunden worden.
Ende November 2019:
Ich sitze vor einem neuen Orthopäden, der mich erstmal drei Monate krankschreibt. „Frau M., wir schaffen das schon. Ich bin für sie da und wir werden so lange nach einer Lösung suchen, bis wir sie finden, ich lasse sie da nicht im Stich.“ Auch er ist davon überzeugt, dass es etwas von der Halswirbelsäule sein muss, weil er die Symptome durch Druck auf meine oberen Halswirbel auslösen kann. Von ihm werde ich von jetzt an jeden Monat zwei- bis fünfmal behandelt werden. Sowohl osteopathisch als auch mit anderen Methoden.
Dezember 2019:
Zwar bin ich krangeschrieben, aber ich habe trotzdem das Gefühl, versagt zu haben. Ich kann zusehen, wie all meine Freunde mit ihrem Leben weitermachen und mit einem Studium oder einer Ausbildung anfangen oder einfach nur reisen. Und ich sitze hier fest und weiß nicht einmal, ob ich überhaupt eine Zukunft habe.
Februar-September 2020:
Jeder Tag ist gleich. Ich stehe auf. Arztbesuch, dann Physiotherapeut, dann noch ein Arztbesuch, dann gehe ich schlafen. Ich würde behaupten, bei jedem Arzt in meiner Stadt schon einmal im Wartezimmer gesessen zu haben.
Dann habe ich gegen März einen Termin bei einem Atlastherapeuten, der mir eine Atlasverschiebung diagnostiziert und mich darauf behandelt. Kurzzeitig hilft es, allerdings hält die Behandlung nicht lange und jedes Mal, wenn sich der Halswirbel zurückverschiebt, werden die Symptome so unerträglich schlimm, dass ich das Gefühl habe, jeden Moment zu sterben. Auch gibt er mir die Nummer einer Therapeutin mit den Worten, dass seine Tochter dort auch mal in Behandlung war und dass ich mit jemandem über das sprechen sollte, was passiert ist.
Und er hatte Recht. Eigentlich hatte ich mir geschworen, all das alleine durchzustehen, weil ich keine Kraft mehr dafür hatte, mit jemandem darüber zu streiten, was mir passierte. Aber gleichzeitig wusste ich, dass es unmöglich war, diese Krankheit zu durchleben, ohne psychische Folgeerkrankungen zu entwickeln. Die Panikattacken und die posttraumatische Belastungsstörung, die sich im Verlauf des Jahres immer stärker ausgeprägt hatten, würde ich nicht alleine in den Griff bekommen. Mein Kopf war Tag und Nacht wie ein Museum für all die grausamen Dinge, die ich eigentlich nur vergessen wollte. Aber eher so die 3D premium experience.
Juli 2020:
So stand ich eines Tages vor der Tür meiner Therapeutin, und obwohl Sie mich nicht kannte und ich ihr ohne jeglichen ärztlichen Beweis von einer mysteriösen Erkrankung erzählte, die niemand kannte und die niemand wirklich nachweisen konnte, aber die ich ganz sicher hatte, hat sie mir alles, was ich erzählt habe, geglaubt. „Haben Sie Angst davor, dass Ihnen mit dieser Krankheit etwas passiert“, werde ich in einer der folgenden Therapiestunden gefragt. Und die Frage klang so unwirklich. Weil man nie jemanden jemals diese Frage stellen hört. Und trotzdem war ich dankbar, dass endlich jemand fragte.
November 2021:
Da sich meine Krankheit soweit gebessert hatte, dass ich manche Tage ganz normal leben konnte, habe ich 2020 begonnen, Zahnmedizin in einer anderen Stadt zu studieren. Nicht unbedingt, weil ich Zahnärztin werden wollte, sondern weil mir die Vorklinik die medizinische Grundbildung ermöglichte, die ich brauchte, um mir selbst helfen zu können. Und so war ich so weit gekommen, dass ich den gesamten anatomischen Aufbau des Körpers kannte und all meine Symptome zuordnen konnte. Nun war ich sicher, dass ich eine Kopfgelenksinstabilität hatte und dass ich diese in Funktionsstellungen in einem Upright-MRT diagnostizieren lassen konnte.
So saß ich im November 2021 in einer radiologischen Praxis für ein Upright-MRT und ließ an zwei Untersuchungstagen Bilder von meiner HWS unter der natürlichen Gewichtsbelastung in Dorsalflexion/Ventralflexion, Rotation und Seitneigung anfertigen.
Ergebnis:
• Atlantoaxiale Instabilität
• Insuffizienz des linken Ligamentum alare und vermutete Insuffizienz des Ligamentum transversum
• Gelenkerguss im atlantoaxialen Gelenk
• Mechanische Affektion der Medulla oblongata (Hirnstamm) bei Rotation des Kopfes
• Verdacht auf Ehlers-Danlos-Syndrom
Die Medulla oblongata ist der Bereich des Gehirns, der durch das Hinterhauptsloch in die Halswirbelsäule ragt und sowohl Atmung als auch Herzschlag steuert. Außerdem gehen von dort viele Hirnnerven ab und wichtige Leitungsbahnen ziehen hindurch, um in den Rest des Körpers zu gelangen.
Dezember 2021:
Mein Orthopäde liest sich meine Befunde durch und schaut mich nachdenklich an. Dann meint er, er kann nichts mehr für mich tun und will den Raum verlassen. Aber ich stoppe ihn, auch wenn ich weiß, dass er Recht hat „Sie haben versprochen, mir zu helfen. Und Sie haben gesagt, dass Sie für mich da sind, sie können mich nicht alleine lassen, bitte. Sie können jetzt nicht gehen.“ Er versucht sehr angestrengt, nicht emotional zu werden, aber ich schaffe es nicht. Die Arzthelferin weint mit mir. „Ich kann Ihnen nicht helfen. Wenn ich es könnte, dann würde ich es tun. Vielleicht könnte Ihnen ein Neurochirurg helfen?“. Aber ich weiß bereits, dass es keinen Arzt dafür in Deutschland gibt. Nur einen Neurochirurgen in Barcelona, aber so eine OP ist auch nicht ohne und unbezahlbar. Als er den Raum verlässt, sieht mich die Arzthelferin traurig an und sagt: „Geben Sie nicht auf, Sie schaffen das, auch wenn Sie das jetzt noch nicht glauben. Irgendwann werden Sie jemanden finden, der Ihnen helfen kann“.
Oktober 2022:
Ich unterbreche wieder mein Studium, weil es mir zu schlecht geht. Mein neuer Hausarzt schaut sich das EKG an, was er gerade gemacht hat, dann meine Befunde, dann mich. „Ich wollte fragen, was man da so machen könnte“, frage ich, obwohl ich die Antwort bereits kenne. Er lacht frustriert und schaut mich an. „Nichts. Es gibt nichts, was man tun könnte. Ich bin da ganz ehrlich mit Ihnen, weil Sie das wissen müssen. Diese Erkrankung ist wirklich selten. Ich würde nicht sagen, dass man nicht vielleicht doch alt damit werden kann, aber leben Sie einfach ihr Leben, machen Sie Dinge, die Ihnen Freude bereiten. Und passen Sie auf jeden Fall auf, keinen Schlag abzubekommen, weil es dann theoretisch sein könnte, dass Sie querschnittsgelähmt sind oder im schlimmsten Fall auch sterben.“
Ein paar Worte von mir, an all die Ärzte, die mir nicht geglaubt haben: Ihr habt mir echt das Gefühl gegeben, verrückt zu sein. Aber ich bin nicht verrückt. Ich denke mir meine Krankheit nicht aus. Ich bin nicht auf der Suche nach Aufmerksamkeit. Und genauso wenig versuche ich mir „ein paar freie Wochen“ zu gönnen. Glaubt mir, ich kann mir schönere Orte als Krankenhäuser und Arztpraxen vorstellen. Ich habe wichtige Teile meiner Jugend und alles, worauf ich mich für meine Zeit nach dem Abitur gefreut habe, verpasst, während ich jeden Tag um mein Leben gekämpft habe.
Ich kann nur allen Ärzten raten: Glaubt euren Patienten und sprecht ihnen nicht ihre Erfahrungen ab. Es gibt kein schlimmeres Gefühl, als zu wissen, dass man Hilfe braucht, aber nicht ernst genommen wird. Ich verstehe nicht, warum es ein regelrechter Trend geworden ist, die Diagnose „Psyche“ direkt als Ausschlussdiagnose zu stellen, anstatt einmal zu sagen, dass man aktuell nicht weiß, was der Patient hat?
Für mich kann ich sagen: Ich habe eines der grausamsten Dinge erlebt, die ein Mensch durchleben kann. Und trotz allem, was passiert ist, bin ich noch hier. Aufgeben ist für mich keine Option. Das Leben geht weiter. Es ist nicht mehr das gleiche, wie es mal war, aber es geht weiter. Diese Krankheit ist bis jetzt nicht heilbar, und trotzdem geht es mir nach 3 Jahren Physiotherapie besser als 2019/2020. Ich weiß das zu schätzen, weil es manch anderen mit dieser Erkrankung leider nicht so ergeht. Aktuell kann ich 70% der Zeit ein schmerzfreies Leben außerhalb meines Bettes führen. Die Herzrhythmusstörungen sind zwar noch vorhanden, aber nicht mehr so bedrohlich, wie sie es mal waren. Einen Anfall habe ich in abgemilderter Form nur noch ca. alle 1-2 Monate. Ja, ich habe Einschränkungen, aber ich lebe. Das ist etwas, was ich mir 2019 nicht ansatzweise hätte vorstellen können.
Ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass einer der größten Fehler, den wir machen, ist, zu denken, dass wir Zeit haben. Und meist wird uns das erst klar, wenn es zu spät ist. Manchmal stelle ich mir vor, dass ich vielleicht wirklich gestorben bin und dann darum gebeten habe, doch zurückgehen zu dürfen. Um noch einmal im Meer stehen zu können, noch einmal einkaufen zu gehen, noch einmal Schnee zu fühlen, mich über kleine Hundewelpen zu freuen und um meinen Freunden zu sagen, wie wichtig sie mir sind. Ich kann nicht sagen, wie es sich bei mir in den nächsten Jahren entwickeln wird, aber ich werde jede Minute, die ich habe, nutzen, weil ich nicht vergessen werde, wie besonders es ist, leben zu dürfen.
Bitte senden Sie Ihre Mails an diese Adresse:
Empfehlen Sie uns auf:
NICHT ÄRZTLICH APPROBIERTE BEHAUPTUNGEN!
Ausgenommen sie sind als solche gekennzeichnet. - Sie befinden sich auf einer Seite betroffener Patienten, also medizinischer Laien. Die auf dieser Seite veröffentlichten Angaben sind jedoch nach bestem Wissen und aus aufrichtigen Motiven erstellt. Die SCHLEUDERTRAUMA-SELBSTHILFE ist unabhängig und nicht kommerziell. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Stand: Juli 2025